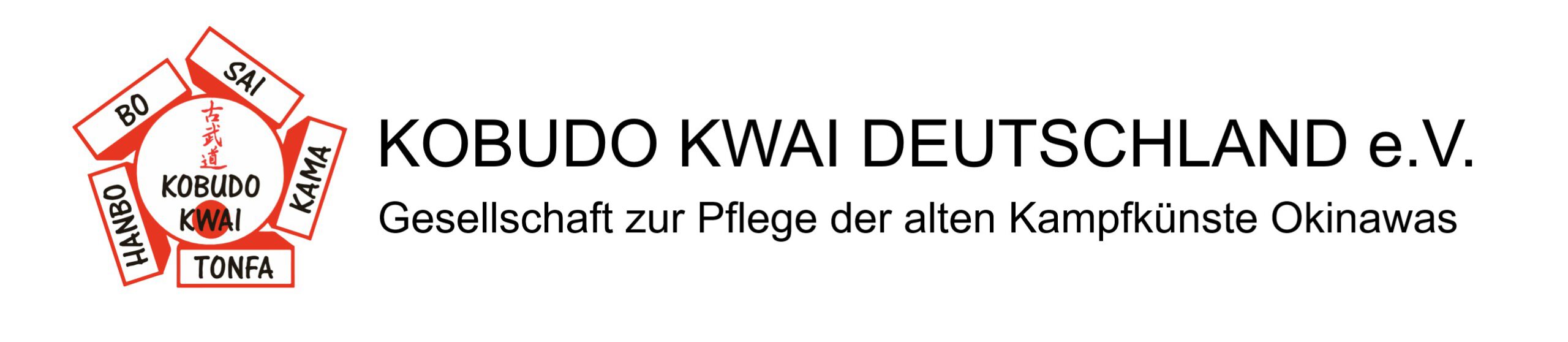Die Geschichte des KKD
Erste Impulse
In Deutschland wächst das Interesse am traditionellen Kobudō Okinawas. Dr. Georg Stiebler veröffentlicht erste Fachartikel und Übersetzungen, die Kobudō einer breiteren
Kampfsportöffentlichkeit bekannt machen. Seine Arbeiten stoßen Neugier und Nachfrage an.
Parallel beginnen Persönlichkeiten wie Willi Stapf und Heinrich Conrads, sich intensiver mit
den Waffenübungen zu befassen. Erste lose Trainingsgemeinschaften entstehen.
Mehr dazu
Gründung des Kobudo Kwai Deutschland in Unna-Billmerich (NRW)
15 engagierte Kampfsportler treffen sich zur Gründungsversammlung. Unter ihnen: Dr. Georg
Stiebler, Willi Stapf, Heinrich Conrads, Erich Hüggenberg und Gispert Krebs. Stiebler wird zum
ersten Präsidenten gewählt. Ziel des neuen Verbandes ist es, das historische Kobudō
Okinawas zu bewahren, zu pflegen und als lebendige Disziplin mit moderner Relevanz
weiterzugeben.
Mehr dazu
Aufbaujahre
Die ersten Dōjōs in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und NRW schließen sich an. Kobudō wird
überwiegend in Karate-Vereinen integriert, gewinnt aber zunehmend Eigenständigkeit. Erste
regionale Lehrgänge finden statt, einheitliche Prüfungsprogramme werden vorbereitet.
Mehr dazu
Konsolidierung
Der KKD wächst zu einer bundesweiten Organisation. Jürgen Mayer (Lauf/Pegnitz)
übernimmt als Präsident, unterstützt von Ralf Rosenberger (Vize) und Andreas Poprawa
(Geschäftsführer). Trainer wie Rainer Seibert und Michael Rapp treten in den Vordergrund.
Der Verband gewinnt internationales Profil, erste Kontakte nach Okinawa entstehen.
Mehr dazu
Tod von Dr. Georg Stiebler
Der erste Präsident und geistige Vater des KKD verunglückt bei einem Hubschrauberabsturz.
Sein Tod reißt eine große Lücke, sein Vermächtnis bleibt.
Mehr dazu
Internationalisierung und Sommerlager
Die Mitgliederversammlung findet in Klatovy (Tschechien) statt. Deutsche, tschechische und
slowakische Vereine arbeiten zusammen. Internationale Sommerlager mit Karate- und
Kobudō-Schwerpunkten werden etabliert.
Mehr dazu
Stärkung der Struktur
Einführung verbindlicher Lehrgänge und Prüfungsprogramme für Bō, Sai, Tonfa und Hanbō.
Ausbau der Kontakte nach Okinawa, besonders zu Tamayose (Tesshinkan) und Oshiro
(Yamanni Ryū).
Mehr dazu
Einführung der Trainer-C-Lizenz Kobudō
Die erste bundesweite Ausbildungslizenz für Kobudō-Trainer wird geschaffen. Ein
Meilenstein, der den Unterricht professionalisiert und Standards setzt.
Mehr dazu
Erste Ehrungen für langjährige Mitglieder
Zahlreiche 10-Jahres-Jubilare (u. a. Roland Dorn, Egbert Gudlat, Klaus Oblinger, Frank Pelny,Michael Rapp, Ralf Rosenberger, Rainer Seibert) sowie viele 5-Jahres-Jubilare (u. a. Katharina
und Ralf Anneser) werden ausgezeichnet.
Mehr dazu
Weitere Jubiläen
Gerd Löber wird für 15 Jahre geehrt, Sven Seibert, Jan George und andere für 10 Jahre.
Lothar Josef Ratschke (1. KV Erfurt) und viele weitere für 5 Jahre. Gleichzeitig nimmt die Zahl
der bundesweiten Lehrgänge zu.
Mehr dazu
Verbindliche Programme & Lehrgänge
Prüfungsprogramme für Bō, Sai und Tonfa werden offiziell verbindlich. Lehrgänge, Turniere
und Austauschveranstaltungen prägen das Verbandsleben.
Mehr dazu
Auszeichnungen für Verdienste
Frank Pelny und Sven Seibert erhalten die bronzene Ehrennadel. Rainer Seibert wird mit der
silbernen Ehrennadel und dem 7. Dan im Gendai Goshin Kobujutsu geehrt.
Mehr dazu
30 Jahre KKD
Der Verband feiert sein 30-jähriges Bestehen. Eine Phase der Rückbesinnung „auf den
wahren KKD“ beginnt.
Ausbau unter Rainer Seibert
Rainer Seibert prägt den Verband organisatorisch und inhaltlich. Sommerlager, Bundes- und
Landeslehrgänge, Reisen nach Okinawa und enge Zusammenarbeit mit Tesshinkan und
Yamanni Ryū festigen den KKD. Prüfungsprogramme werden erweitert, Dan-Prüfungen
konsolidiert.
Mehr dazu
Weitere Ehrungen
Im Rahmen des Sommerlagers 2016 werden erneut verdiente Mitglieder ausgezeichnet.
Gemeinschaft und Anerkennung prägen das Bild.
Pandemiezeit
Die Corona-Pandemie bremst Lehrgänge und Prüfungen. Der Verband hält mit digitalen
Formaten, kleineren Gruppen und Zusammenhalt durch.
Tod von Rainer Seibert
Der langjährige Vorsitzende verstirbt. Der Verband verliert seine prägende Persönlichkeit,
trauert und bereitet den Übergang in eine neue Struktur vor.
Mehr dazu
Satzungsreform & Neuaufstellung
Die Mitgliederversammlung verabschiedet eine neue Satzung und Ordnungen. Sven Seibert
wird Vorsitzender, Karsten Matzdorf stellvertretender Vorsitzender, Stefan Lünse Geschäftsführer. Einführung eines erweiterten Vorstands, klare Rolle der Stilrichtungsreferenten.
Mehr dazu
Aufbruch in eine neue Ära
Der KKD präsentiert sich demokratisch breiter aufgestellt, mit klaren Verantwortlichkeiten
und einer gestärkten Lehr- und Prüfungsarbeit. Die Verbindung von Tradition und Moderne
prägt die Zukunft.
Mehr dazu
Die Vorboten (1979 – 1981)
Wenn man die Geschichte des Kobudo Kwai Deutschland e. V. erzählen will, darf man nicht erst mit der offiziellen Gründung beginnen. Die entscheidenden Impulse, die zu dieser Gründung führten, entstanden schon einige Jahre vorher, am Ende der 1970er-Jahre. Es war eine Zeit, in der das Karate in Deutschland längst etabliert war. Dojos existierten in allen großen Städten, Prüfungen folgten klaren Linien, Wettkämpfe hatten ihre eigenen Stars hervorgebracht. Und doch spürten viele Übende, dass etwas fehlte.
Denn wer sich tiefer mit den Katas beschäftigte, stellte fest: Zahlreiche Bewegungen ließen sich im waffenlosen Kontext nur schwer erklären. Warum blockt man mit beiden Armen gleichzeitig? Wozu dienen Bewegungsfolgen, die aussehen, als wolle man etwas greifen, drehen oder mit Kraft halten? Warum wirken manche Abläufe ohne Gegenstand in der Hand fast unnatürlich?
Diese Fragen führten unweigerlich zum Kobudō. Auf Okinawa war es seit Jahrhunderten selbstverständlich, dass Karate und Kobudō zwei Seiten derselben Medaille waren. Viele Katas ließen sich nur verstehen, wenn man wusste, dass bestimmte Bewegungen ursprünglich mit einem Bō oder Sai in der Hand ausgeführt wurden.
Doch in Deutschland wusste Ende der 1970er fast niemand etwas darüber. Literatur war kaum vorhanden, japanische Lehrer für Kobudō so gut wie unerreichbar. Hier kam ein Mann ins Spiel, der für die weitere Entwicklung entscheidend war: Dr. Georg Stiebler.
Stiebler war nicht nur ein leidenschaftlicher Karateka, sondern auch ein wissenschaftlich arbeitender Kopf. Er besaß die Fähigkeit, Dinge nicht nur auszuführen, sondern zu hinterfragen, zu analysieren und zu dokumentieren. Ab 1979 begann er, erste Artikel und Übersetzungen über das Kobudō zu veröffentlichen. Seine Texte erschienen in Fachzeitschriften und waren für viele die allererste Begegnung mit den Waffen Okinawas. Darin erklärte er die Herkunft des Bō, die Funktion der Sai, die Verwendung der Tonfa. Er machte Zusammenhänge sichtbar, die Karateka bislang verborgen geblieben waren.
Diese Artikel wurden in der Szene wie ein Geheimtipp weitergereicht. Wer sie las, verstand plötzlich: Das, was in der Kata unklar wirkt, ist im Kobudō logisch. Bewegungen bekamen einen Sinn, der weit über sportliche Technik hinausging. Stieblers Texte öffneten Türen – intellektuell und praktisch.
Parallel dazu begannen Praktiker wie Willi Stapf und Heinrich Conrads, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Sie probierten in kleinen Trainingsgruppen aus, was Stiebler beschrieb. Mit dem, was an Literatur und Bildern zur Verfügung stand, stellten sie erste Übungsreihen zusammen. Die Treffen waren oft improvisiert, getragen vom Enthusiasmus der Beteiligten.
In diesen Jahren entstand eine kleine, aber wachsende Bewegung. Karateka, die tiefer verstehen wollten, suchten den Kontakt zu Stiebler und seinen Mitstreitern. Noch fehlte die Struktur, noch gab es keine gemeinsame Organisation. Aber die Idee war geboren: Kobudō verdient eine eigene Plattform in Deutschland.
Zurück zum Zeitstrahl
Die Gründung des KKD (1982)
Am 2. April 1982 war es so weit: In Unna-Billmerich (Nordrhein-Westfalen) trafen sich 15 engagierte Kampfsportler, um einen Verband ins Leben zu rufen, der fortan die Entwicklung des Kobudō in Deutschland prägen sollte.
Die Versammlung war nicht groß im äußeren Rahmen, aber von ungeheurer Bedeutung. Ein Gemeindehaus, einfache Tische, vielleicht ein paar Stühle aus der örtlichen Turnhalle – und Männer, die mit ernster Miene und zugleich spürbarer Begeisterung beisammensaßen. Viele hatten die weite Anreise in Kauf genommen, um an diesem historischen Moment teilzunehmen. Jeder wusste: Heute legen wir den Grundstein für etwas, das bleiben soll.
Unter den Gründungsmitgliedern waren die Namen, die schon in den Jahren zuvor als Motoren der Entwicklung hervorgetreten waren: Dr. Georg Stiebler, der zum ersten Präsidenten gewählt wurde, Willi Stapf, Heinrich Conrads, Erich Hüggenberg, Gispert Krebs und weitere. Jeder von ihnen brachte einen Teil der Pionierarbeit mit ein: Stiebler die intellektuelle und publizistische Basis, Stapf die praktische Erfahrung und unermüdliche
Trainingsarbeit, Conrads, Hüggenberg und Krebs die regionale Verwurzelung in ihren Vereinen.
Die Atmosphäre dieser Gründungsversammlung lässt sich heute nur noch erahnen. Es war keine nüchterne Vereinsgründung im üblichen Sinne. Es war die Geburt einer Bewegung. Die Männer, die an diesem Tag zusammenkamen, waren sich bewusst, dass sie nicht nur einen Verein gründeten, sondern ein Stück Verantwortung für die Bewahrung und Weitergabe einer jahrhundertealten Kunst übernahmen.
In der ersten Satzung wurden die Ziele klar formuliert: Das historische Kobudō Okinawas sollte bewahrt und gepflegt werden. Es sollte nicht in Museen verschwinden oder auf wenige Spezialisten beschränkt bleiben, sondern lebendig trainiert, verstanden und weitergegeben werden. Der Verband wollte Prüfungsprogramme entwickeln, Lehrgänge organisieren und Lehrer ausbilden. Jeder Verein, der sich anschloss, sollte eine Stimme haben, Entscheidungen sollten demokratisch gefällt werden.
Mit Georg Stiebler als Präsidenten hatte der Verband eine Persönlichkeit an der Spitze, die nicht nur organisieren, sondern auch inspirieren konnte. Er verband Theorie und Praxis, dokumentierte, schrieb, erklärte – und wusste zugleich, wie wichtig das regelmäßige Training auf der Matte war.
Die Gründung des KKD war damit mehr als ein organisatorischer Akt. Sie war ein Bekenntnis: Kobudō sollte in Deutschland eine Heimat haben. Eine Heimat, die auf Verantwortung, Wissen und gemeinsamer Leidenschaft gründet.
Zurück zum Zeitstrahl
Die Aufbaujahre (1980er)
Die ersten Jahre nach der Gründung waren von Enthusiasmus, Pioniergeist und viel improvisierter Arbeit geprägt. Der neue Verband hatte zwar eine Satzung, einen Präsidenten und ein Ziel, doch Strukturen mussten erst wachsen. Alles, was selbstverständlich wirkte – einheitliche Prüfungsprogramme, regelmäßige Rundbriefe, große Lehrgänge – musste mühsam aufgebaut werden.
In den 1980er-Jahren schlossen sich nach und nach die ersten Dojos aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen an. Kobudō fand in dieser Zeit noch fast ausschließlich in Karate-Dojos statt, doch es begann, eine eigene Identität zu entwickeln. Lehrer und Schüler merkten bald: Diese Waffenarbeit ist mehr als nur eine Ergänzung – sie ist ein eigenständiger Weg.
Die Waffen Bō, Sai, Tonfa und Kama standen im Mittelpunkt. Erste Prüfungsprogramme wurden in kleinen Schritten erarbeitet. Anfangs bestanden sie aus groben Orientierungspunkten: Grundtechniken, einfache Partnerübungen, erste Formen. Aber sie gaben Schülern und Lehrern Halt. Wer im Norden trainierte, konnte nun ähnliche Inhalte erlernen wie jemand im Süden – ein bedeutender Schritt in Richtung Einheitlichkeit.
Ein besonderes Merkmal dieser Aufbauzeit war die publizistische Tätigkeit von Georg Stiebler. Er schrieb Broschüren, fertigte Übersetzungen japanischer Quellen an, dokumentierte Techniken und Hintergründe. Diese Schriften waren in einer Zeit ohne Internet von unschätzbarem Wert. Sie zirkulierten von Hand zu Hand, wurden kopiert, studiert, mit Anmerkungen versehen. Für viele Mitglieder waren sie die einzige schriftliche Grundlage
ihres Kobudō-Trainings. Stieblers Doppelrolle als Präsident und Publizist gab dem Verband eine einzigartige Prägung: Der KKD war von Anfang an nicht nur eine Trainingsgemeinschaft, sondern auch eine Dokumentations- und Forschungsstätte.
Die 1980er waren außerdem eine Zeit der ersten regionalen Lehrgänge. Noch gab es keine Bundeslehrgänge im großen Stil, aber kleine Treffen, bei denen Schüler aus verschiedenen Dojos zusammenkamen, um gemeinsam zu trainieren. Diese Lehrgänge hatten oft den Charakter von Familientreffen. Man lernte, übte, lachte, tauschte Erfahrungen aus. Die Stimmung war geprägt von dem Bewusstsein, etwas Neues aufzubauen.
Natürlich lief nicht alles reibungslos. Es gab Diskussionen über Inhalte, über Prüfungsmodalitäten, über die Rolle einzelner Waffen. Aber gerade diese
Auseinandersetzungen halfen, eine gemeinsame Linie zu finden. Stück für Stück wuchs der Verband, nicht durch spektakuläre Auftritte, sondern durch die geduldige Arbeit vieler Hände.
Am Ende des Jahrzehnts war der KKD noch klein, aber er hatte Wurzeln geschlagen. Dojos in mehreren Bundesländern, erste Programme, regelmäßige Treffen – und ein wachsendes Bewusstsein, dass hier etwas entstanden war, das bleiben würde.
Zurück zum Zeitstrahl
Die Konsolidierung (1990er)
Mit Beginn der 1990er-Jahre trat der Kobudo Kwai Deutschland in eine Phase der Konsolidierung ein. Nach den wilden Aufbaujahren der 1980er, in denen vieles noch improvisiert war, stand nun die Festigung der Strukturen im Vordergrund. Immer mehr Dojos traten bei, die Mitgliederzahlen stiegen, und der Verband begann, sich als feste Größe in der deutschen Budō-Landschaft zu etablieren.
Die Führung des KKD lag nun in den Händen einer neuen Generation. Jürgen Mayer aus Lauf an der Pegnitz wurde Präsident, Ralf Rosenberger aus Hessen übernahm das Amt des Vizepräsidenten, und Andreas Poprawa aus Thale führte als Geschäftsführer die organisatorischen Geschäfte. Dieses Trio sorgte für Stabilität und gab dem Verband ein klares Gesicht. Unter ihrer Leitung wurden die Aktivitäten breiter aufgestellt und in geregelte
Bahnen gelenkt.
Die 1990er waren von einem deutlichen Zuwachs an Lehrgängen geprägt. Bundesweite Treffen fanden häufiger statt, und die Teilnehmerzahlen stiegen kontinuierlich. Die Waffenarbeit wurde strukturierter, Prüfungsprogramme konkreter formuliert. Es gab nun klar definierte Inhalte für die einzelnen Gürtelstufen, auch wenn diese noch nicht den späteren Detaillierungsgrad hatten. Für die Schüler bedeutete das: Sie wussten erstmals verlässlich, was in einer Prüfung erwartet wurde.
Ein weiteres wichtiges Instrument dieser Zeit waren die Rundbriefe. In einer Zeit ohne Internet waren sie das Bindeglied zwischen den Mitgliedern. Sie enthielten Berichte von Lehrgängen, Ankündigungen, theoretische Beiträge, manchmal auch Diskussionen über inhaltliche Fragen. Für viele Mitglieder waren die Rundbriefe das sichtbare Zeichen, dass sie Teil einer größeren Gemeinschaft waren.
Inhaltlich begann sich in den 1990ern auch die Tür zur Internationalisierung zu öffnen. Erste Kontakte nach Okinawa wurden geknüpft. Japanische Lehrer kamen nach Deutschland, und einzelne deutsche Budōka wagten die Reise nach Japan und Okinawa. Noch waren es kleine Schritte, aber sie zeigten: Der KKD wollte nicht in sich selbst verharren, sondern die Verbindung zu den Ursprüngen suchen.
Doch mitten in dieser Phase traf den Verband ein schwerer Schlag: 1997 verstarb Dr. Georg Stiebler bei einem Hubschrauberabsturz, der erste Präsident und geistige Vater des KKD.
Mit ihm verlor der Verband nicht nur einen Gründer, sondern auch den Mann, der durch seine Publikationen und sein Engagement das Kobudō in Deutschland überhaupt erst sichtbar gemacht hatte. Sein Tod markierte das Ende einer Ära. Viele Mitglieder erinnerten sich an ihn nicht nur als Funktionär, sondern als Mentor und Vorbild.
Trotz dieser Lücke blieb sein Erbe lebendig. Seine Texte wurden weiter genutzt, seine Ideen prägten die Denkweise im Verband. In gewisser Weise wirkte er auch nach seinem Tod weiter: als Fundament, auf dem die nächste Generation bauen konnte.
Die 1990er waren so eine Zeit des Übergangs: weg vom kleinen Kreis der Pioniere, hin zu einem strukturierten Verband mit wachsender Basis, klareren Regeln und ersten internationalen Kontakten. Am Ende des Jahrzehnts war der KKD bereit, in eine neue Phase einzutreten – die der Internationalisierung und des Ausbaus.
Zurück zum Zeitstrahl
Die Internationalisierung (1999–2003)
Das Jahr 1999 markierte für den Kobudo Kwai Deutschland einen Wendepunkt. Nach fast zwei Jahrzehnten Aufbauarbeit, wachsender Mitgliederbasis und zunehmender Struktur war nun die Zeit gekommen, die Türen weiter zu öffnen. Die Mitgliederversammlung fand in
Klatovy (Tschechien) statt – ein deutliches Zeichen dafür, dass der Verband seine Arbeit nicht nur auf Deutschland beschränken wollte.
Die Versammlung in Klatovy brachte deutsche, tschechische und slowakische Vereine zusammen. Erstmals spürte man deutlich, dass Kobudō eine Sprache war, die über nationale Grenzen hinweg verstanden wurde. Dort, wo zuvor der Austausch auf kleine Lehrgänge beschränkt war, entstand nun etwas Neues: internationale Sommerlager, in denen Karate und Kobudō parallel gelehrt wurden. Diese Treffen waren Feste der Begegnung. Man
trainierte tagsüber, diskutierte abends bei gemeinsamen Mahlzeiten, tauschte Ideen aus und knüpfte Freundschaften. Viele Teilnehmer erinnern sich, dass sie zum ersten Mal das Gefühl hatten, Teil einer größeren, internationalen Gemeinschaft zu sein.
Inhaltlich war diese Zeit von großer Bedeutung. Zwischen 2000 und 2003 wurden die Prüfungsprogramme systematisch ausgearbeitet. Bō, Sai, Tonfa und Hanbō erhielten feste Strukturen. Was zuvor in Ansätzen existierte, wurde nun verbindlich und schriftlich fixiert.
Für die Schüler bedeutete das, dass sie einen klaren Fahrplan erhielten, und für die Lehrer bedeutete es, dass sie ihre Ausbildung bundesweit auf ein gemeinsames Fundament stellen konnten.
Parallel dazu intensivierte sich der Kontakt nach Okinawa. Besonders wichtig wurden die Beziehungen zu Tamayose Hidemi, Sensei (Tesshinkan) und Oshiro Toshihiro, Sensei (Yamanni Ryū). Diese Meister öffneten deutschen Budōka neue Perspektiven. Tamayose, Sensei brachte die Klarheit des Tesshinkan mit, Oshiro, Sensei vermittelte die Dynamik des Yamanni-Ryū. Der KKD gewann durch diese Kontakte nicht nur technisches Wissen, sondern auch Legitimation und Verankerung in der internationalen Kobudō-Szene.
Die Internationalisierung hatte auch eine symbolische Komponente. Während in den 1980ern und frühen 1990ern das Kobudō in Deutschland noch fast wie eine exotische Randerscheinung behandelt wurde, war es nun ein anerkannter Teil der Budō-Welt. Der KKD zeigte, dass er nicht nur inländisch Strukturen aufbauen konnte, sondern auch auf Augenhöhe mit Lehrern und Verbänden in Japan und Okinawa trat.
Die Jahre 1999 bis 2003 können so als die Zeit beschrieben werden, in der der KKD aus den Kinderschuhen trat und zu einem Verband von nationaler und internationaler Bedeutungheranwuchs. Es war die Phase, in der sich zeigte: Die Vision von Stiebler, Stapf und den anderen Gründern hatte Wurzeln geschlagen und trug nun Früchte.
Zurück zum Zeitstrahl
Vom Verein zum Verband (2004–2010)
Nach der Phase der Internationalisierung begann für den Kobudo Kwai Deutschland eine Zeit, in der sich die zuvor erarbeiteten Grundlagen festigten und vertieften. Die Jahre von 2004 bis 2010 waren geprägt von einem Wandel: Aus einer Bewegung, die noch stark vom Enthusiasmus Einzelner getragen war, entwickelte sich ein Verband mit klaren Strukturen, festen Programmen und einer eigenen Kultur.
Ein Meilenstein dieser Zeit war die Einführung der Trainer-C-Lizenz Kobudō (2003/2004). Erstmals konnten Lehrer im Rahmen des Verbandes eine formale Qualifikation erwerben, die nicht nur ihr Können bestätigte, sondern auch ihre Fähigkeit, Wissen weiterzugeben. Für viele Trainer war dies ein wichtiger Schritt: Sie erhielten eine offizielle Anerkennung ihrer Arbeit und zugleich eine Verpflichtung, die hohen Standards des Verbandes einzuhalten. Der KKD setzte damit Maßstäbe und zeigte, dass er Kobudō als eigenständige Disziplin mit professionellem Anspruch verstand.
Parallel dazu wurden die Prüfungsprogramme weiter ausgebaut und verbindlich gemacht. Nun gab es für alle wesentlichen Waffen – Bō, Sai, Tonfa und Hanbō – festgelegte Inhalte, die bundesweit galten. Schüler wussten genau, welche Techniken, Formen und Partnerübungen auf welcher Stufe gefordert waren. Lehrer erhielten damit eine klare Leitlinie für ihre Unterrichtsgestaltung. Diese Vereinheitlichung war eine der großen Leistungen dieser Jahre, denn sie gab dem Verband eine gemeinsame Sprache.
Auch die Kultur der Ehrungen wurde in dieser Zeit fester Bestandteil des Verbandes. 2004 wurden zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet, die sich über viele Jahre für den Verband engagiert hatten. Namen wie Roland Dorn, Egbert Gudlat, Klaus Oblinger, Frank Pelny, Michael Rapp, Ralf Rosenberger und Rainer Seibert wurden für zehn Jahre Treue geehrt. Für fünf Jahre Mitgliedschaft erhielten unter anderem Katharina und Ralf Anneser eine Auszeichnung. Diese Ehrungen hatten mehr als symbolischen Wert: Sie machten deutlich, dass der Verband die Arbeit seiner Mitglieder sah und schätzte.
In den folgenden Jahren kamen weitere hinzu: 2005 erhielt Gerd Löber die Ehrung für 15 Jahre Mitgliedschaft, 2006 wurden Thomas Dolp, Jan George, Josef Komander, Christof Liebl und Sven Seibert für zehn Jahre ausgezeichnet. Unter den Fünfjährigen jener Zeit war auch Lothar Josef Ratschke vom 1. KV Erfurt. Dazu kamen viele weitere Namen, die in den Rundbriefen genannt wurden: Christoph Beisegel, Stephan Dörfler, Falko Große, Joachim Pabst, Olaf Richter, Andreas Schaller, Hagen Walter, Daniela Rau, Sabine Woisetschläger und viele andere. Sie alle zeigten, dass der Verband nicht nur von den großen Namen lebte, sondern von einer breiten Basis getragen wurde.
Inhaltlich stand diese Phase auch im Zeichen von Innovation. Neue Trainingssysteme wie das „Hanbō Light“ wurden entwickelt, um Anfängern einen sicheren Einstieg zu ermöglichen.Erste Kobudō-Meisterschaften fanden statt, die das Profil des Verbandes nach außen stärkten. Rundbriefe zeigten eine enorme Aktivität: Fast monatlich gab es irgendwo in Deutschland Lehrgänge, die Teilnehmer aus verschiedenen Regionen zusammenführten.
Doch diese Jahre brachten auch Verluste. Dr. Georg Stiebler, der geistige Vater des Verbandes, war bereits 1997 verstorben. Nun zog sich auch Willi Stapf, die zweite prägende Figur der Gründung, aus der aktiven Arbeit zurück. Damit endete die Ära der Gründer. Ihre Vision lebte weiter, doch die Verantwortung lag nun in den Händen einer neuen Generation.
Die Zeit von 2004 bis 2010 war damit eine Phase des Übergangs. Der Verband wuchs, gewann Struktur und Stabilität. Zugleich verabschiedete er sich von den Männern, die ihn ins Leben gerufen hatten. Es war eine Zeit des Dankes und der Weichenstellung: Dank an die Pioniere, die den Weg bereitet hatten, und Weichenstellung für die kommenden Jahre, in denen eine neue Generation das Ruder übernehmen sollte.
Zurück zum Zeitstrahl
Die Ära Rainer Seibert (2010–2025)
Mit dem Beginn der 2010er-Jahre trat der Kobudo Kwai Deutschland in eine neue Phase ein. Nachdem sich die Gründergeneration verabschiedet hatte, brauchte der Verband eine neue Leitfigur. Diese Rolle übernahm Rainer Seibert, der in den Jahrzehnten zuvor bereits durch sein Engagement aufgefallen war und nun als Präsident in die erste Reihe trat.
Rainer Seibert war kein Funktionär im klassischen Sinne. Er war ein Mann, der das Kobudō lebte, der es verstand, Strukturen aufzubauen, und zugleich ein Herz für die Menschen hatte. Unter seiner Führung begann eine Zeit, die für viele Mitglieder bis heute prägend ist.
Eine seiner großen Leistungen war der Ausbau der Lehrgänge. Bundes- und Landeslehrgänge wurden systematisch organisiert und regelmäßig durchgeführt. Fast jedes Wochenende konnte man irgendwo in Deutschland an einem Seminar teilnehmen. Das bedeutete nicht nur Training, sondern auch Begegnung. Mitglieder aus verschiedenen Regionen trafen sich, tauschten aus, lernten voneinander. Diese Lehrgänge wurden zu einem sozialen und fachlichen Rückgrat des Verbandes.
Besonders hervorzuheben sind die Sommerlager, die unter Seiberts Führung zu festen Institutionen wurden. Hier kamen Mitglieder aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen, um mehrere Tage lang intensiv zu trainieren. Die Atmosphäre dieser Lager war einzigartig: Tagsüber konzentriertes Arbeiten an den Waffen, abends gemeinsames Beisammensein, Diskussionen, Freundschaften. Für viele Mitglieder sind die Sommerlager bis heute die
schönsten Erinnerungen an ihre Zeit im KKD.
Ein weiteres Feld, das Seibert intensiv vorantrieb, war die Verbindung nach Okinawa. Reisen dorthin wurden organisiert, deutsche Delegationen trainierten bei okinawanischen Meistern, besuchten Dojos und knüpften Kontakte. Umgekehrt kamen Lehrer aus Okinawa regelmäßig nach Deutschland, um Seminare zu leiten. Dieser Austausch gab dem Verband nicht nur Legitimation, sondern auch Tiefe. Wer einmal in Okinawa trainiert hatte, spürte die Wurzeln des Kobudō – und brachte dieses Gefühl zurück in die deutschen Dojos.
Inhaltlich wurde in dieser Zeit enorm viel geleistet. Die Prüfungsprogramme wurden erweitert und verbindlich etabliert. Für alle wichtigen Waffen – Bō, Sai, Tonfa, Kama und Hanbō – entstanden klare, bundesweit gültige Programme. Auch die Dan-Prüfungen im Gendai Goshin Kobujutsu wurden eingeführt. Damit erreichte der Verband ein Ausbildungsniveau, das in Deutschland einzigartig war. Schüler hatten nun einen verlässlichen Weg, auf dem sie sich entwickeln konnten, und Trainer erhielten klare Leitlinien für ihre Arbeit.
Auch die Kultur der Ehrungen wurde fortgeführt. Auf der Mitgliederversammlung 2010 erhielten Frank Pelny und Sven Seibert die bronzene Ehrennadel des Verbandes. Rainer Seibert selbst wurde mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet und erhielt zugleich den 7. Dan im Gendai Goshin Kobujutsu – eine Auszeichnung, die seine Verdienste würdigte und seine Rolle als führende Persönlichkeit unterstrich. In den folgenden Jahren kamen weitere Ehrungen hinzu, etwa 2016 beim Sommerlager, wo erneut Mitglieder für ihr Engagement ausgezeichnet wurden.
Neben diesen organisatorischen und technischen Leistungen war es vor allem Seiberts Persönlichkeit, die den Verband prägte. Er war bekannt für seine Herzlichkeit und Offenheit. Wer ihn traf, spürte, dass er das Kobudō nicht nur verwaltete, sondern lebte. Er war Mentor, Freund und Präsident zugleich. Viele Mitglieder berichten, dass sie sich durch ihn persönlich gesehen und gefördert fühlten. Er verstand es, Menschen für das Kobudō zu begeistern und sie in die Gemeinschaft einzubinden.
Auch schwierige Zeiten meisterte er. Die Corona-Pandemie von 2020 bis 2022 war eine der größten Herausforderungen. Lehrgänge mussten abgesagt, Prüfungen verschoben werden. Viele Dojos standen still. Doch der Verband hielt zusammen. Unter Seiberts Führung wurden digitale Treffen eingeführt, kleinere regionale Gruppen organisiert und der Kontakt aufrechterhalten. Dieser Zusammenhalt half, die Krise zu überstehen.
Die letzten Jahre seiner Amtszeit waren von Kontinuität geprägt. Lehrgänge fanden wieder regelmäßig statt, Prüfungen wurden abgehalten, die Verbindung nach Okinawa blieb bestehen. Der Verband stand stabil und gefestigt da.
Doch 2025 kam der tiefe Einschnitt: Rainer Seibert verstarb. Mit ihm verlor der KKD nicht nur seinen langjährigen Präsidenten, sondern auch eine Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg das Gesicht des Verbandes gewesen war. Sein Tod hinterließ eine große Lücke. Für viele war er nicht nur ein Vorsitzender, sondern der Mensch, der ihnen das Kobudō nahegebracht hatte.
Die Ära Rainer Seibert war eine Zeit des Wachstums, der Stabilität und der Internationalisierung. Unter seiner Führung wurde der KKD zu einem Verband von bundesweiter und internationaler Bedeutung. Sein Vermächtnis prägt den Verband bis heute.
Zurück zum Zeitstrahl
Die Neuausrichtung (2025)
Das Jahr 2025 brachte für den Kobudo Kwai Deutschland einen tiefen Einschnitt. Mit dem Tod von Rainer Seibert verlor der Verband seine prägende Figur der letzten anderthalb Jahrzehnte. Viele Mitglieder verbanden mit ihm nicht nur organisatorische Stärke, sondern auch persönliche Nähe. Sein Verlust bedeutete Trauer – und zugleich die Notwendigkeit, den Verband auf neue Beine zu stellen.
Der Nachruf im Newsletter machte deutlich, welche Spuren er hinterlassen hatte: Als langjähriger Präsident, als Träger des 8. Dan Gendai Goshin Kobujutsu, als Lehrer, der unermüdlich das Wissen weitergab, und als derjenige, der den Verband mit den Stilen Tesshinkan und Yamanni Chinen Ryū verbunden hatte. Viele erinnerten sich nicht nur an sein organisatorisches Geschick, sondern vor allem an seine Menschlichkeit – an den Lehrer, der
immer offen war für Fragen, an den Mentor, der andere wachsen ließ.
Die Antwort auf diese Lücke gab die Mitgliederversammlung am 30. August 2025. An diesem Tag wurde eine neue Satzung verabschiedet, die den Verband strukturell modernisierte und demokratisch stärkte. Damit begann eine neue Ära.
Im Mittelpunkt stand die Neugestaltung des geschäftsführenden Vorstands. Anders als früher, wo die Autorität stark in einer Person konzentriert war, wurde die Verantwortung nun auf drei Schultern verteilt:
• Sven Seibert, Sohn von Rainer, wurde zum Vorsitzenden gewählt. Er bringt nicht nur die familiäre Verbindung, sondern auch jahrelange eigene Erfahrung im Kobudō ein. Als Bindeglied zwischen Tradition und Zukunft symbolisiert er die Kontinuität und zugleich den Aufbruch.
• Karsten Matzdorf, ein Urgestein des Verbandes mit 5. Dan im Kobudō und 3. Dan im Shōgen Ryū, übernahm die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden. Er ist seit Jahrzehnten aktiv, kennt den Verband aus allen Perspektiven und steht für Stabilität.
• Stefan Lünse, dessen organisatorische Klarheit und Begeisterung für die Kampfkunst bereits in vielen Projekten sichtbar wurde, wurde zum Geschäftsführer gewählt. Er bringt frische Energie und strukturierte Arbeitsweise in die Führung ein.
Diese Dreiteilung war nicht nur ein organisatorischer Schritt, sondern auch ein philosophisches Signal: Der Verband sollte nicht mehr von einer starken Einzelperson abhängen, sondern als Team geführt werden, in dem Verantwortung geteilt und Kontrolle gesichert ist.
Eine weitere bedeutende Neuerung war die Einführung des erweiterten Vorstands. Dieses Gremium, besetzt mit Mitgliedern aus verschiedenen Städten, stellt sicher, dass die Interessen des Verbandes bundesweit gleichmäßig vertreten sind. Eine klare Regel wurde verankert: Kein Mitglied des erweiterten Vorstands darf aus derselben Stadt stammen wie ein anderes. Damit wird verhindert, dass eine Region zu dominant wird, und es entsteht einGleichgewicht, das die Vielfalt des Verbandes sichtbar macht. Beispiele hierfür sind Martina Gunkel, die über Jahre hinweg im Hintergrund als helfende Kraft unverzichtbar war und nun offiziell eine Funktion erhielt, sowie Marcus Gebauer, der als 2. Dan Kobudō Verantwortung übernahm.
Parallel dazu wurde die Rolle der Stilrichtungsreferenten präzisiert. Sie gehören nicht zum Vorstand, sondern wirken als Experten und Funktionsträger in der Lehre. Ihre Aufgabe ist es, die Waffenprogramme zu entwickeln, das Wissen zu vertiefen und es in die Breite zu tragen. Koordiniert wird ihre Arbeit durch Sven Seibert, der als „Koordinator aller Waffen“ die Schnittstelle bildet und sicherstellt, dass die Programme stimmig bleiben und sich
weiterentwickeln.
Ein weiteres Zeichen der Zukunft war die geplante Okinawa-Reise 2025. Training im Budōkan und Kaikan, Begegnungen mit Meistern und Einblicke in die Kultur sollten wieder Brücken schlagen zwischen den deutschen Mitgliedern und der Wiege des Kobudō. Dieser internationale Austausch unterstreicht, dass der KKD nicht nur nach innen wächst, sondern auch nach außen verbunden bleibt.
Nicht zuletzt stand im Newsletter die Einladung an alle Mitglieder: sich stärker einzubringen, Anträge zu stellen, Ideen einzubringen, Verantwortung zu übernehmen. Diese neue Partizipationskultur ist ein Schritt hin zu mehr Offenheit, Demokratie und vor allem Transparenz im Verband.
Die Satzungsreform von 2025 war damit mehr als eine bloße Anpassung. Sie war ein Neuanfang, der den Verband auf eine breitere, demokratischere und zukunftsfähigere Basis stellte. An die Stelle der Ära des starken Präsidenten trat eine Ordnung, die Verantwortung verteilt, Vielfalt sichtbar macht und Stabilität schafft.
Zurück zum Zeitstrahl
Ausblick und Bedeutung
Mehr als vier Jahrzehnte nach seiner Gründung steht der Kobudo Kwai Deutschland an einem neuen Scheideweg – und zugleich auf einem festen Fundament. Die Satzungsreform von 2025 hat nicht nur organisatorische Strukturen verändert, sondern auch ein neues Selbstverständnis geprägt: Der Verband ist stärker, weil er Verantwortung auf viele Schultern verteilt und weil er in der Vielfalt seiner Mitglieder eine Einheit findet.
Die kommenden Jahre werden zeigen, wie fruchtbar dieser Schritt ist. Die Einführung des erweiterten Vorstands und die klare Rolle der Stilrichtungsreferenten geben dem Verband Stabilität. Sie sorgen dafür, dass sowohl organisatorische Fragen als auch technische Inhalte in Balance bleiben. Mit dem monatlichen Honbu-Training, den bundesweiten Techniktagen und den internationalen Brücken nach Okinawa verfügt der KKD über feste Säulen, auf denen er wachsen kann.
Die geplante Okinawa-Reise 2025 und die Fortführung des Austauschs mit den dortigen Meistern sind mehr als symbolische Gesten. Sie verkörpern den Anspruch, dass das Kobudō im KKD nicht isoliert lebt, sondern im Dialog mit seinen Wurzeln. Gerade für jüngereMitglieder sind diese Begegnungen prägend: Sie erleben, dass die Waffen nicht nur in deutschen Turnhallen trainiert werden, sondern Teil einer jahrhundertealten Tradition sind, die bis heute in Okinawa gepflegt wird.
Doch die größte Stärke des Verbandes liegt nicht in Strukturen, Reisen oder Prüfungsprogrammen. Sie liegt in den Menschen. In den Lehrern, die ihr Wissen mit Geduld weitergeben. In den Schülern, die sich auf den langen Weg machen. In den Helfern wie Martina, Klaus, Matze, Wolf und vielen mehr, die oft unbemerkt im Hintergrund wirken. In den vielen Mitgliedern, die über Jahre hinweg treu geblieben sind und durch ihre
Anwesenheit das Fundament bilden.
Philosophisch betrachtet spiegelt der KKD die Essenz des Budō: Kraft entsteht nicht aus der Dominanz eines Einzelnen, sondern aus der Harmonie des Ganzen. So wie der Bō seine volle Wirkung erst entfaltet, wenn beide Hände im Gleichgewicht arbeiten, so entfaltet ein Verband seine Stärke, wenn viele Stimmen gehört werden und in eine gemeinsame Richtung wirken.
Für junge Karateka ist der KKD eine Einladung, den Horizont zu erweitern. Wer nur Karate kennt, ahnt oft nicht, wie sehr das Verständnis der Katas wächst, wenn man mit Bō, Sai oder Tonfa trainiert. Kobudō im KKD ist ein Schlüssel zu tieferem Verständnis – und ein Abenteuer, das den eigenen Weg bereichert. Für erfahrene Budōka ist der Verband ein Ort, an dem Wissen nicht verloren geht, sondern lebendig weitergegeben wird.
Die Kultur der Ehrungen, die den Verband seit den frühen 2000er-Jahren begleitet, macht dies sichtbar. Namen wie Roland Dorn, Egbert Gudlat, Klaus Oblinger, Frank Pelny, Michael Rapp, Ralf Rosenberger oder Lothar Ratschke stehen stellvertretend für viele andere. Sie zeigen, dass Treue und Beständigkeit genauso wichtig sind wie technische Fortschritte.
So steht der Kobudo Kwai Deutschland heute da: geformt von den Pionieren der 1980er, gestärkt durch die Internationalisierung der 1990er, gefestigt durch die Strukturarbeit der 2000er, geprägt durch die Ära Rainer Seibert und erneuert durch die Satzungsreform von 2025.
Die Zukunft liegt nun in den Händen einer Gemeinschaft, die gelernt hat, dass Stärke aus Vielfalt erwächst. Der Verband ist bereit, seinen Weg weiterzugehen – zwischen Tradition und Moderne, zwischen Heimat und Okinawa, zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Zurück zum Zeitstrahl