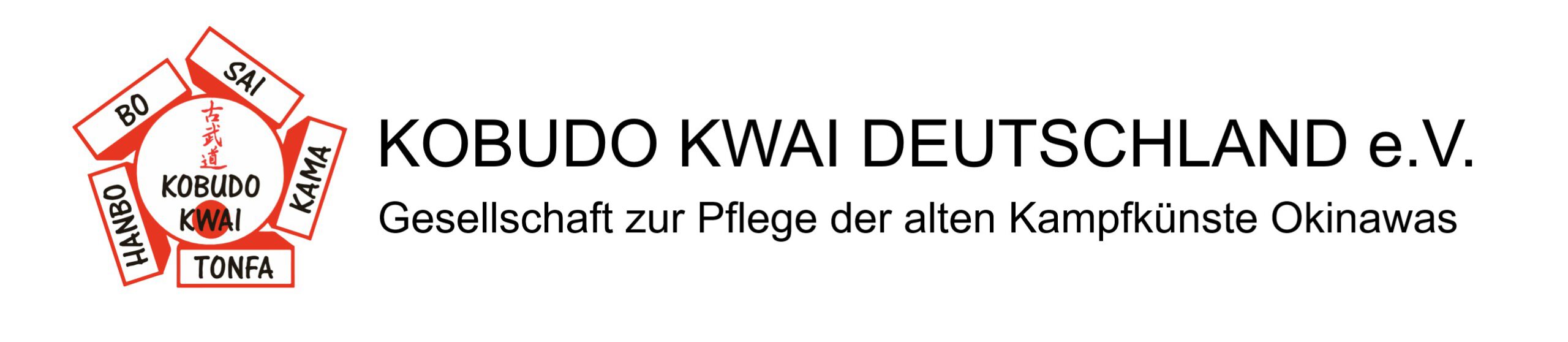Hanbō-Jutsu (半棒)
Geschichte und Herkunft des Hanbō
Der Hanbō, der „halbe Stab“, ist eine der interessantesten Waffen des japanischen Budō, weil er sich von den meisten anderen Kobudō-Waffen deutlich unterscheidet. Mit seinen knapp 90 Zentimetern Länge ist er weder so lang wie der Bō noch so kurz wie das Tantō. Seine Besonderheit liegt gerade in der Zwischenstellung, eine Brückenwaffe, die sowohl Distanzkontrolle erlaubt als auch Techniken des Nahkampfes in sich trägt.
Anders als viele klassische Waffen des Okinawa-Kobudō, die aus bäuerlichen Werkzeugen hervorgegangen sind, wie etwa die Kama (Sichel) oder die Tōnfa (Mühlsteingriff), hat der Hanbō seinen Ursprung nicht in der Agrargesellschaft der Ryūkyū-Inseln. Vielmehr ist er in Japan selbst entstanden, eng verbunden mit Samurai, Polizei und Schulen des Ninjutsu. Auf
Okinawa war der Hanbō traditionell kaum verbreitet, teilweise sogar verpönt, weil man ihn dort nicht als Teil der eigenen Kultur ansah. Das änderte sich erst, als sich im 20. Jahrhundert moderne Selbstverteidigungssysteme etablierten, die auch Elemente aus dem japanischen Budō aufnahmen.



Eine der bekanntesten Überlieferungen zum Ursprung des Hanbō geht auf einen Vorfall im Japan des 16. Jahrhunderts zurück. Ein Samurai soll in einem Kampf seinen Bō zerbrochen haben. Er nutzte die verbliebene Hälfte und stellte fest, dass sich mit diesem „halben Stab“ überraschend viele wirkungsvolle Techniken ausführen ließen. Der Hanbō war geboren, nicht
aus theoretischer Planung, sondern aus praktischer Notwendigkeit. Von da an wurde er systematisch in verschiedenen Schulen trainiert.
Im feudalen Japan diente der Hanbō nicht nur Kriegern, sondern auch Ordnungshütern. Polizeikräfte setzten ihn ein, um Personen zu kontrollieren, Waffen abzulenken oder Festnahmen durchzuführen. Anders als ein Schwert konnte er defensiv eingesetzt werden, ohne zwangsläufig schwere Verletzungen zu verursachen. Diese Rolle als Werkzeug der Kontrolle prägte sein Image über Jahrhunderte hinweg.
Auch die Ninjutsu-Schulen übernahmen den Hanbō. Für sie war er eine ideale Alltagswaffe, weil er unauffällig war und sich leicht tarnen ließ. In manchen Überlieferungen gilt er als Symbol der Improvisation: Mit einem Spazierstock, einem Stockwerkzeug oder einem ähnlichen Gegenstand ließen sich die Prinzipien des Hanbō jederzeit anwenden. Diese Alltäglichkeit, gepaart mit Flexibilität, macht die Waffe auch heute noch relevant für die Selbstverteidigung.
Charakteristisch für den Hanbō sind drei Aspekte: Erstens die Vielseitigkeit, er kann zum Blocken, Schlagen, Stoßen, Hebeln oder Werfen genutzt werden. Zweitens die Kontrolle, mit ihm lassen sich Bewegungen des Gegners aufnehmen, lenken und binden. Drittens dieDistanz, er ermöglicht es, den Gegner auf Abstand zu halten oder die Distanz blitzschnell zu verkürzen.
In der Geschichte des Budō nimmt der Hanbō daher eine Sonderstellung ein. Er ist keine typische Bauernwaffe aus Okinawa, sondern eine japanische Ergänzung, die im Laufe der Zeit bewusst in moderne Systeme integriert wurde. Im Gendai Goshin Kobujutsu bildet er heute eine der Hauptwaffen, weil er die Brücke zwischen Tradition und moderner Selbstverteidigung schlägt.
Als Referent für das Hanbō vermittelt Sven Seibert die Tiefe dieser kompakten Waffe. Er prägt mit seinem Wissen die Hanbō-Ausbildung im KKD.
„Tradition bewahren, Zukunft gestalten – das ist mein Weg im Kobudō.“
Graduierungen
6. Dan Gendai Goshin Hanbo Jutsu
4. Dan Gendai Goshin Kobu Jutsu
2. Dan Hanbo Jutsu DJJV
1. Dan Ryukyu Kobudo Tesshinkan
1. Dan Yammani Shinen Ryu
Instructor Kobu Jutsu Gold
Instructor Hanbo Jutsu Gold
Instructor Bo Jutsu Gold
Instructor Tonfa Jutsu Gold
Downloads
Training im KKD
Im Kobudo Kwai Deutschland (KKD) hat der Hanbō eine besondere Rolle. Er ist nicht nur eine Waffe unter vielen, sondern der Ausgangspunkt für das Verständnis von Distanz, Timing und Technikvielfalt. Im Prüfungsprogramm des Gendai Goshin Kobujutsu wird er als erste Distanzwaffe behandelt und begleitet die Schüler durch mehrere Stufen bis zum Dan.
Bereits in den unteren Kyū-Graden lernen die Schüler einfache Schlag- und Stoßbewegungen sowie die ersten Abwehrtechniken. Ein großer Schwerpunkt liegt auf Griffwechseln und Handwechseln. Der Hanbō zwingt dazu, den Stock mühelos zwischen rechter und linker Hand zu wechseln und dabei stets die Kontrolle zu behalten. Dazu kommen Übungen mit der
Schwungebene, die das sichere Kreisen der Waffe um den Körper trainieren. Diese Fähigkeiten wirken auf den ersten Blick unscheinbar, sind aber zentral für alle weiteren Waffentechniken.
Das Prüfungsprogramm ist dabei bewusst systematisch aufgebaut:
- Hanbō Shodan vermittelt Grundschläge, Blockbewegungen und einfache Kombinationen.
- Hanbō Nidan baut darauf auf, erweitert um Drehungen und erste Hebel.
- Hanbō Sandan vertieft die Partnerarbeit und führt komplexere Abläufe ein.
- Hanbō Yondan rundet den Weg ab, indem die Techniken miteinander verknüpft und taktisch eingesetzt werden.
Dieser Stufenaufbau zeigt den didaktischen Wert der Waffe. Während bei den klassischen Doppelwaffen, also Tōnfa, Sai und Kama, bis zum 3. Kyū ein adaptiver Fortschritt für beide Hände parallel angelegt ist, dient der Hanbō als Einstieg in das beidhändige Führen einer Einzelwaffe. Er ist damit ein Brückeninstrument, das sowohl Einfachheit als auch Komplexität in sich trägt.
Besonders wertvoll ist die Partnerarbeit. Hier zeigt sich, wie vielseitig der Hanbō einsetzbar ist: als Hebelwerkzeug, als Blockhilfe oder zur Distanzkontrolle. Schüler lernen, wie sie Angriffe entschärfen, ohne den Gegner zu verletzen, und wie sie gleichzeitig Distanz schaffen, um Zeit für eine Entscheidung zu gewinnen.Darüber hinaus hat der Hanbō im KKD einen hohen praktischen Bezug. Er ist ein ideales Werkzeug, um das Prinzip der Improvisation zu schulen. Viele Alltagsgegenstände, von Spazierstöcken bis zu Werkzeuggriffen, lassen sich mit denselben Bewegungsmustern nutzen.
Damit erfüllt der Hanbō eine wichtige Rolle in der modernen Selbstverteidigung, in der es nicht immer um das Mitführen traditioneller Waffen geht, sondern um das Übertragen von Prinzipien.
Nicht zuletzt ist der Hanbō im KKD ein Symbol für die Verbindung zwischen japanischer Tradition und moderner Trainingsmethodik. Er zeigt, wie eine Waffe, die historisch auf Polizei und Samurai zurückgeht, in ein zeitgemäßes System eingebunden werden kann. Das Ergebnis ist ein Training, das sowohl die historische Authentizität wahrt als auch die Bedürfnisse heutiger Budōka erfüllt.
Trainingsinhalte Hanbō
Das Training mit dem Hanbō verbindet grundlegende Schlag- und Abwehrbewegungen mit vielseitigen Griff- und Handwechseln. Im Gendai Goshin Kobujutsu werden klassische Bewegungsmuster mit modernen Methodiken kombiniert, um die Waffe als praktisches
Lehrmittel zu nutzen.
- Grundlegende Griffwechsel und Handwechsel
- Seitenwechsel in Bewegung
- Schwungebene in alle Richtungen
- Schläge und Stöße auf verschiedene Distanzen
- Block- und Kontertechniken
- Hebel- und Festlegetechniken
- Partnerübungen für Distanz und Timing
- Anwendungen aus dem Ninjutsu (z. B. Verkeilen, Würgen, Klemmen)
- Kombination mit waffenlosen Abwehrbewegungen
- Kata zur Vermittlung historischer Bewegungen
Warum Hanbo-Training wichtig ist
Das Hanbō-Training ist eine Schule der Balance zwischen Distanz und Nähe. Es schult
Körperkoordination, Kraft und Präzision, zugleich auch Ruhe und Übersicht. Der Hanbō
zwingt den Übenden, ständig die Distanz zum Partner neu zu regulieren – eine Fähigkeit, die in jeder Selbstverteidigungssituation von entscheidender Bedeutung ist.
- Verbesserung von Distanzgefühl und Timing
- Stärkung von Koordination und Dynamik
- Erlernen universeller Prinzipien für andere Waffen
- Schulung von Griffwechseln und beidhändigem Arbeiten
- Förderung von Reaktion und Bewegungsfluss
- Verbindung von Tradition (Kata) und moderner Selbstverteidigung
- Anwendung im Partnertraining ohne gefährliche Eskalation
Drei Fakten Hanbo
1.
Eine der ältesten Waffen der Menschheitsgeschichte (weltweit verbreitet, nicht nur in
Japan oder Okinawa)
2.
Fundamentale Basiswaffe des Kobudō mit eigenständigen Kata
3.
Schule für Ganzkörperkoordination und universelle Prinzipien